Was tun bei einer Krebsdiagnose?
Herr Schmidt, Frau Gutmann: Fast alle haben Angst davor, an Krebs zu erkranken. Was raten Sie Menschen, die eine solche Diagnose bekommen?
Kurt W. Schmidt: Ruhe bewahren! Das ist zwar leichter gesagt, als getan, denn Krebs ist die Krankheit, vor der wir uns am meisten fürchten. Viele beschreiben, dass ihnen „der Boden unter den Füßen weggezogen“ wurde. Doch Krebs ist nicht gleich Krebs. Manche Krebserkrankungen haben gute Behandlungschancen, andere schlechte, weil sie zum Beispiel schon zu weit fortgeschritten sind. Für jeden ist es anders. Wichtig ist, Halt an einem Geländer zu finden.
Claudia Gutmann: Im Akutkrankenhaus sprechen wir mit Menschen oft kurz nach der Mitteilung der Diagnose, wenn sie noch erschrocken oder sogar in einem richtigen Schockzustand sind. Wir vermitteln, dass diese ersten psychischen Reaktionen wie Erstarrung oder Beunruhigung sowie Unglauben ganz „normale Zustände“ sind auf eine neue und dramatische Situation, die die Seele verständlicherweise bei vielen Menschen zunächst überfordert. Es ist wichtig, dass die Betroffenen ihre emotionale Situation einordnen können, die medizinischen Informationen verstehen und dass sie eine Perspektive für die nahe und weitere Zukunft bekommen.
Wie geht das vor sich?
Gutmann: Kurz nach der Diagnose besprechen wir mit den Patient*innen vor allem, was ihnen für die nächsten Stunden und Tage hilft: Wer kann unterstützen? Wie kann der Fokus weg von der Angst gelenkt werden? Was hilft zur eigenen Beruhigung? Im weiteren Verlauf geht es darum, die Zuversicht als hilfreiche Bewältigungsstrategie zu fördern und gemeinsam mit den Betroffenen zu klären, was hilfreich für sie ist, um sich auf die neue Lebenssituation mit der oft sehr langen Behandlung einzustellen.
Warum ist eigentlich Krebs stärker emotional besetzt als andere Krankheiten?
Schmidt: Der amerikanische Onkologe Siddharta Mukherjee, der im Jahr 2010 das wohl beste Buch über die Geschichte der Krebserkrankung geschrieben hat, nennt den Krebs den „Herrscher“, den „König aller Krankheiten“. Sein Buch über den Krebs ist eine Art „Biografie“. Das erscheint ungewöhnlich, doch von kaum einer anderen Krankheit sprechen wir wie von einem eigenen Wesen, einer eigenen Person, die heimtückisch zuschlägt, sich ausbreitet und gegen die der Patient, die Ärzte, die Forscher ankämpfen. Krebs ist seit 4500 Jahren bekannt, wobei Krebs nicht „eine“ Krankheit ist, sondern viele Erscheinungsformen hat. Viele Krebserkrankungen sind heute besser therapierbar als allgemein bekannt. Doch zugleich ist Krebs auch eine Erkrankung des Alters, und da wir immer älter werden, steigt unser Risiko, an Krebs zu erkranken und einem längeren Sterbeprozess ausgesetzt zu sein. Wir wollen aber lieber gesund sein bis ins hohe Alter und – wenn es dann schon sein muss – lieber schnell versterben.
Wenn der erste Schockzustand verflogen ist: Würden Sie dann dazu raten, sich die eigene Situation mit nüchterner Ehrlichkeit klarzumachen, also zum Beispiel auch die eigene Diagnose zu googeln, oder ist ein bisschen Schönreden erlaubt?
Schmidt: Heutzutage schaut fast jeder im Internet nach, was er über eine Erkrankung findet. Alles, was man dort liest, hat mehr oder weniger Auswirkungen auf das eigene Befinden. Das ist schon lange von Medizinstudent*innen bekannt, dass Krankheiten, die gerade im Studium Thema sind, sorgenvoll daraufhin überprüft werden, ob man nicht selbst daran leidet. Körperliche Symptome werden hierbei häufig fehlgedeutet und erzeugen Angst. So wissen wir heute, dass allein das Lesen eines Beipackzettels mit den Beschreibungen möglicher Nebenwirkungen beim aufmerksamen Leser dazu führen kann, dass er die beschriebenen Symptome auch bekommt. Und da im Internet eine Fülle von Informationen existieren, deren Wahrheitsgehalt der Laie in der Regel nur schwer beurteilen kann, sollte der Patient oder Angehörige bevorzugt auf die Internetseiten gehen, die seriöse Fachinformationen anbieten (z.B.: www.krebsinformationsdienst.de) und den Arzt als Lotsen durch dieses Dickicht an Informationen nutzen.
Gutmann: Gerade in der Diagnose- und Behandlungsphase sind Patient*innen oft mit sehr beunruhigenden Erfahrungen konfrontiert und haben eine „Überdosis“ Angst. Die erschwert es, sich dem Leben zuzuwenden. Dann ist es durchaus sinnvoll, die Angst in ihre Schranken zu verweisen. Meist erleben die Patient*innen ein Pendeln zwischen den Polen Zuversicht und Angst und spüren auch sehr genau, wann sie neue Informationen gut verkraften können.
Was können Freund*innen und Angehörige tun?
Schmidt: Die Nachricht von der Erkrankung kann bei mir als Angehörigem oder Bekannten belastende Erinnerungen, Sorgen und Ängste auslösen. Ich selbst sollte mich dann nicht überfordern im Bestreben, für den Anderen da zu sein. Hier hilft ein offener und ehrlicher Umgang, auch mit sich selbst. Grundsätzlich sind Freunde, Bekannte und Angehörige sehr wichtig, auch wenn sie häufig das Gefühl haben, „nichts“ Wichtiges tun zu können. Doch wir Menschen sind soziale Wesen und benötigen Unterstützung in verschiedenen Bereichen: auf der körperlichen, geistigen, sozialen und spirituellen Ebene. Da muss und kann ich als Angehöriger oder Bekannter nicht für alle Bereiche zuständig sein. Auch will kein Patient 24 Stunden am Tag tiefgründige Gespräche über den Sinn des Lebens und das Schicksal der eigenen Erkrankung führen. Deshalb kann es sehr willkommen sein, wenn ich als Nachbar vorbeischaue und „nur“ von meinem letzten Erlebnis beim Spaziergang mit dem Hund erzähle oder was im Kleingartenverein los war. Das kann so gut tun, auf diese Weise weiter am Leben teilzunehmen und mithineingenommen zu werden. Einfach fragen, was der oder die Erkrankte möchte und ansprechen, was mich selbst bewegt oder wo ich mir unsicher bin: „Ich würde gern mit Dir darüber sprechen, bin mir aber nicht sicher, ob Du das gerade willst“, oder „Ich würde gerne dies (oder jenes) für Dich tun, ich weiß aber nicht, ob Dir das gefällt.“
Gutmann: Es ist sehr wichtig, gerade in Zeiten, in denen das Leben fordernd ist, zum einen gut wahrzunehmen, wie es mir geht und zum anderen auch darüber zu sprechen, und zwar zur eigenen Entlastung, aber auch um die vertrauten Menschen zu informieren. In Zeiten von Druck und in Krisen kommt es verständlicherweise oft erst einmal zu einer „Kommunikationsverknappung“. Das führt dann dazu, dass die Betroffenen sich alleine fühlen oder dass es zu Verunsicherung und Missverständnissen kommt. Jeder macht sich Gedanken um den anderen und stellt Vermutungen darüber an, wie es dem anderen geht und was er braucht. Niemand ist alleine krank. Eine Krebserkrankung betrifft – sicherlich in unterschiedlicher Weise je nach der Bedeutung der Beziehung – alle Menschen, die mit der krebskranken Person verbunden sind. Man kann sich Familien oder auch andere Beziehungsgeflechte wie ein Mobilé vorstellen. Kommt eine Figur in Bewegung, verändern sich die anderen automatisch mit. Wichtig ist daher, miteinander über die eigenen Gefühle, Sorgen und Bedürfnisse zu sprechen.
Besonders schwierig ist das vermutlich gegenüber Kindern.
Gutmann: Ja. Kinder von krebskranken Menschen müssen in kind- und altersgerechter Weise über die Erkrankung des Elternteils informiert werden. Vielen Eltern fällt das natürlich schwer. Wir müssen uns jedoch bewusst machen, dass Kinder in der Regel schnell spüren, dass etwas Besorgniserregendes passiert ist. Das kann dann beunruhigend sein. Bei einem offenen Umgang mit der Erkrankung haben die Eltern die Möglichkeit, unrealistische Vorstellungen zu entkräften und dem Kind helfen, sich zu beruhigen. Neben der psychoonkologischen Beratung für die krebskranken Menschen gibt es daher auch Unterstützungsangebote für Kinder und die ganze Familie. Wir erleben in den Beratungen aber auch oft, dass die Betroffenen sich gut selbst helfen können und dass durch die Erkrankung gute Entwicklungen auf den Weg gebracht werden.
Im Februar findet in der Evangelischen Akademie Frankfurt (Römerberg 9, Beginn jeweils 18.30 Uhr) eine Vortragsreihe zum Thema „Um Leben und Tod – Grundfragen der modernen Krebsmedizin“ statt. Sie setzt sich mit Beiträgen aus Medizin, Psychologie, Philosophie, Musik und eigener Krankheitserfahrung mit den existenziellen Fragen auseinander, die durch eine Krebserkrankung aufgeworfen werden. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung wird erbeten unter www.evangelische-akademie.de oder Telefon 069 174152613. Hier die Veranstaltungen im Einzelnen:
Dienstag, 4. Februar: "Über die Metapher des Bösen"
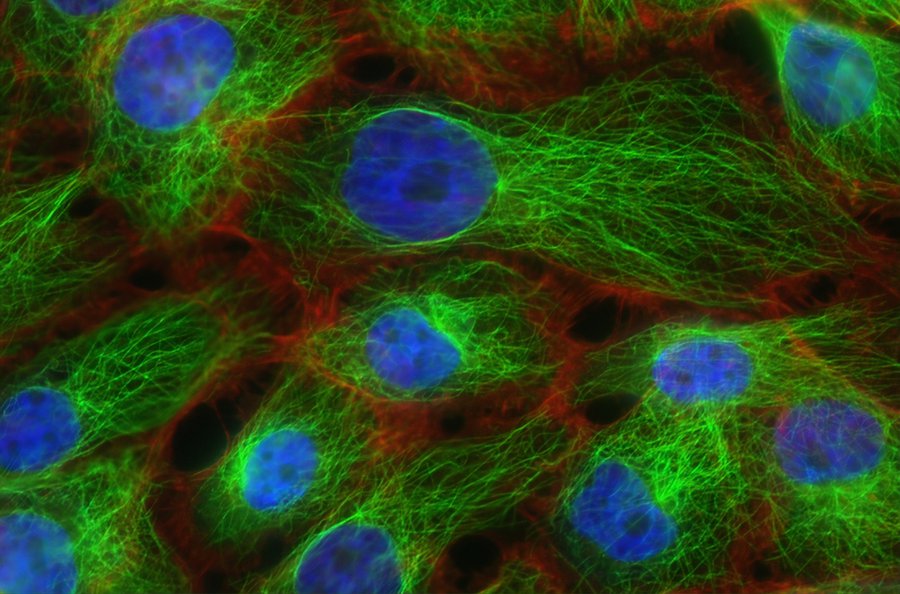

1 Kommentar
Es liest sich so gut, so schön und so durchdacht. Die Praxis sieht leider völlig anders aus. Wenn davon gesprochen wird: "Kurz nach der Diagnose besprechen wir mit den Patient*innen vor allem, was ihnen für die nächsten Stunden und Tage hilft: Wer kann unterstützen? " passiert genau das Gegenteil im Markus. Nach meiner Krebsdiagnose ging es nur noch um die OP, die sicherlich interessant und aufwändig war, ich als Mensch bin gerade im Markus völlig alleine gelassen worden. Man ist 23,5 Stunden mit sich alleine auf Station und hier hat niemand auch nur ein Angebot gemacht. Es ging gleich in die Chemo und danach in die OP. Wenn Worte nicht mit Leben gefüllt werden, dann mag die Absicht zwar nobel sein, der Wert für Betroffene ist und bleibt Null. Aber es gibt ja auch einen Weg, den man beschreiten kann: Raus aus den Kommissionen und Ideen und Gedanken mit Leben füllen. Gerade im Markus wäre das mal was neues.